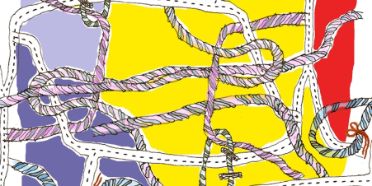- Forschungsprojekt
REFPER - Reproduktive Gesundheit. Die Perspektive geflüchteter Frauen
Für Frauen mit Fluchtbiografie bestehen in der Schweiz Versorgungslücken in der reproduktiven Gesundheit. In unserem Projekt setzten wir uns mit der Sichtweise der Betroffenen auseinander und befragten ihre Bedürfnisse und Erfahrungen. Die Erkenntnisse möchten wir der Öffentlichkeit mit dem Projekt «REFPER goes Society» zugänglich machen.
Steckbrief
- Beteiligte Departemente Hochschule der Künste Bern
-
Institut(e)
Geburtshilfe
Institute of Design Research - Förderorganisation Andere
- Laufzeit (geplant) 01.03.2022 - 31.07.2024
- Projektleitung Milena Wegelin
-
Projektmitarbeitende
Milena Wegelin
Nour Abdin
Loraine Olalia
Beatrice Kaufmann
Tahmina Taghiyeva
Elif Gökalp
Fatma Leblebici
Saba Salomon
Nour Abdin
Laila Sarra -
Partner
Onedu
Kultur- & Sozialgeographie, Universität Bern
Sexuelle Gesundheit Schweiz (SGCH) - Schlüsselwörter Sexuelle und reproduktive Gesundheit, Geflüchtete Frauen, Familienplanung, Verhütung, Reproduktive Gerechtigkeit
Ausgangslage
Die Vorgängerstudie REFUGEE (2017) der Berner Fachhochschule hat für geflüchtete Frauen in der Schweiz diverse Zugangsbarrieren zur perinatalen Gesundheitsversorgung identifiziert und im Bereich Familienplanung und Verhütung eine Versorgungslücke nachgewiesen.
Darauf aufbauend erhebt die Studie REFPER die Perspektive von geflüchteten Frauen in der Schweiz in ihren Erfahrungen bezüglich reproduktiver Gesundheit im Allgemeinen und im Zugang zur Familienplanung und Verhütung im Spezifischen. Im Zentrum stehen die individuellen Bedürfnisse dieser Frauen, welche durch ihren biografischen Kontext und Wissensressourcen geprägt sind. Dabei wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Erfahrungen geflüchteter Frauen im Bereich ihrer sexuellen und reproduktiven Gesundheit in einem Spannungsfeld verschiedener sozio-kultureller und politischer Kräfte stehen.
Vorgehen
Das Forschungsprojekt besteht aus vier aufeinander aufbauenden Phasen.
Erste Phase: Eruierung der Forschungsfelder
In einem ersten Schritt wurden Fachpersonen aus dem Gesundheits- und Migrationsbereich sowie geflüchtete Frauen zur gesellschaftlichen Relevanz der Forschungsthematik befragt und mögliche Forschungsfragen diskutiert und definiert.
Zweite Phase: Prüfung der Umsetzbarkeit
In einer zweiten Phase wurde in einem fünfmonatigen Pilotprojekt die Umsetzbarkeit des Forschungsanliegens geprüft. In dieser Pilotphase wurden explizit die Vorgehensweisen in der Kontaktaufnahme zu den geflüchteten Frauen sowie das Interviewsetting und die Interviewführung ausprobiert, reflektiert und angepasst. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Arbeit und der Rolle von Dolmetschenden im Forschungsprozess führte zu der Entscheidung, eine interkulturelle Dolmetscherin mit Fluchterfahrung als Projektmitarbeiterin einzustellen. Auf diese Weise wurde ein partizipatives Forschungsdesign initiiert und entwickelt.
Dritte Phase: Hauptstudie mit sechs Co-Forschenden mit Erfahrungswissen
Für die Hauptstudie wurde es durch eine Begleitgruppe von sechs Co-Forschenden mit Erfahrungswissen im Kontext von Flucht und Asyl ergänzt. Die Co-Forschenden unterstützten die Datenanalyse in der Hauptstudie durch regelmässige Gruppendiskussionen.
Vierte Phase: Wissen zugänglich machen
Die vierte laufende Phase dient der Kommunikation der Ergebnisse mit einem partizipativen Ansatz. In Zusammenarbeit mit den Co-Forschenden, der Hochschule der Künste (HKB) und dem Projektpartner Onedu werden die Projektthematik, der methodische Ansatz und die zentralen Forschungsergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Unter anderem fand am 26. Juni 2024 die Tagung «Reproduktive Gerechtigkeit im Fluchtkontext: Inputs und Workshops aus Forschung und Praxis» statt.
Eindrücke von der Tagung zur reproduktiven Gesundheit im Juni 2024
Ergebnisse
Für geflüchtete Frauen ist der Zugang zu Verhütungsmitteln durch die aufenthaltsrechtliche Situation geprägt. Mangelnder Zugang zu fachlicher Beratung stellen Barrieren dar und beeinträchtigen reproduktive Rechte. Betroffene weisen zudem auf die erschwerten Umstände von Schwangerschaft und Mutterschaft in der kollektiven Unterbringung hin: Eine Schwangerschaft während des Aufenthalts in kollektiven Unterbringungsstrukturen wollen viele der befragten Frauen vermeiden.
Der Ansatz der Reproduktiven Gerechtigkeit berücksichtigt diese umfassendere Perspektive. Er ist der Schlüssel dazu, die Lebenssituation, die Voraussetzungen und die Entscheidungsmöglichkeiten von geflüchteten Frauen zu verstehen. Dabei fällt auf, dass sie mit reproduktiver Ungerechtigkeit in verschiedenen Facetten konfrontiert sein können:
-
In kollektiven Unterbringungen kann es sich für geflüchtete Frauen als Schwierigkeit herausstellen, nicht schwanger zu werden, da kein umfassender Zugang zu Beratung und Information in Verhütungsfragen und gesicherter Zugang zu Verhütungsmitteln gewährleistet wird.
-
Weiter kann sich eine Schwangerschaft in dieser Lebenssituation und der Versorgungslage in kollektiven Unterbringungen als äusserst schwierig gestalten und geflüchtete Frauen davon abhalten.
-
Die Unterbringung in kollektiven Strukturen kann aus der Perspektive von geflüchteten Frauen auch auf eine räumliche Verhinderung von Sexualität hinwirken und schränkt so die reproduktiven Voraussetzungen auf einer weiteren Ebene ein.
Der umfassende Forschungsbericht ist auf unserer Webseite einsehbar. Der Bericht der Co-Forschenden fasst die Ergebnisse online zusammen.
Publikationen & Vorträge
Publikation Forschungsbericht
Weitere Publikationen
- Wegelin, M., Abdin, N., Sieber, C. (2024). «Reproduktive Gerechtigkeit im Fluchtkontext – Neue Perspektiven», In: Obstetrica 4/5.
- Metthez, C., Wegelin, M., Sieber, C. (2024).«Selbstbestimmte Familienplanung: Haben Geflüchtete Zugang zu Beratung?», In: Obstetrica 4/5.
- Metthez, C., Wegelin, M., Sieber, C. (2024). «Selbstbestimmte Familienplanung: Haben Geflüchtete Zugang zu Beratung?», lange Version
- Artikel in der Zeitschrift FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung des Informationsdiensts der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), 2023 (.pdf)
English version: Impediments to accessing contraception in asylum centres: The perspectives of refugee women in Switzerland - Artikel im Journal Public Health Forum, 2021
- Artikel im BFH-Magazin «frequenz», 2021
Medienbeiträge
- Hauptstadt, 4.7.2024, Frau sein nach der Flucht
- WoZ Die Wochenzeitung, 20.6.2024, Als wäre Gesundheit nebensächlich
- Interview mit Nour Abdin und Milena Wegelin in der Zeitschrift des interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung IZFG der Universität Bern «genderstudies», 2023 (.pdf)
- Radio RaBe, Sendung «Bi aller Liebi...», So kann und will ich nicht schwanger werden, 2023
Vorträge
- Vortrag an den Gosteli Gesprächen 2023 «Institutionelle Politiken der (Ab)wertung von Mutterschaft im schweizerischen Asylwesen». Zusammen mit Laura Perler, Universität Bern (.pdf)
- Vortrag an der 6.Internationale Konferenz der DGHWi e.V. (28. Juli 2022 / Winterthur)
- Vortrag und Workshops im Rahmen der Ringvorlesung «Reproduktive Gerechtigkeit» des interdisziplinären Zentrums für Geschlechterstudien (IZFG) der Universität Bern
Ausstellung
Forschungskollaboration
- Projekt «reproductive geopolitics», Kultur- & Sozialgeographie, Universität Bern
Förderorganisationen
Projektteam

Fachtagung